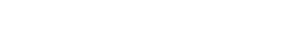Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 3/2013:
Arbeitsrecht
- Kündigungsschutz: Leiharbeitnehmer und Größe des Betriebs
- AGG: Altersbedingte Diskriminierung eines Stellenbewerbers
- Arbeitslohn: Pflicht zur Lohnzahlung besteht auch bei Krankheitsanfälligkeit
- Bewerbungsgespräch: Frage nach Schwangerschaft ist auch bei Schwangerschaftsvertretung unzulässig
Baurecht
- AGB: Eine Abkürzung der Verjährungsfrist für Werklohnansprüche ist unwirksam
- Baumangel: Voraussetzungen für eine Haftung wegen arglistigem Verschweigen des Verkäufers
- Schlussrechnung: Auch nach zwei Monaten sind Einwendungen noch möglich
- Gerichtsstand: Die Vergütung aus einem Bauvertrag ist am Sitz des Bauherren einzuklagen
Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht (WEG)
- Aktuelle Gesetzgebung: Mietrechtsänderungsgesetz passiert den Bundesrat
- Kündigungsrecht: Rückstand von zwei Mieten muss nicht immer abgewartet werden
Verbraucherrecht
- Aktuelle Gesetzgebung: Patientenrechtegesetz passiert den Bundesrat
- Schadenersatzrecht: Ausfall eines Internetanschlusses
- Reiserücktrittsversicherung: Versicherungsschutz kann auch bei Grunderkrankung bestehen
Verkehrsrecht
- Autowerkstatt: Haftung für Fehldiagnose bei einem Kostenvoranschlag
- Ausfallschaden: Neuwagen war im Unfallzeitpunkt schon bestellt
- Unfallschadensregulierung: Kosten für einen Kostenvoranschlag sind erstattungspflichtig
- Abschleppkosten: Keine Preisvergleichspflicht bei Erteilung des Abschleppauftrags
- Entziehung der Fahrerlaubnis: Absehen von der Entziehung bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
Abschließende Hinweise
Arbeitsrecht
Kündigungsschutz: Leiharbeitnehmer und Größe des Betriebs
Nach § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG gilt das Kündigungsschutzgesetz für nach dem 31.12.2003 eingestellte Arbeitnehmer nur in Betrieben, in denen in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt werden. Bei der Berechnung der Betriebsgröße sind auch im Betrieb beschäftigte Leiharbeitnehmer zu berücksichtigen, wenn ihr Einsatz auf einem „in der Regel“ vorhandenen Personalbedarf beruht. Dies gebietet eine an Sinn und Zweck orientierte Auslegung der gesetzlichen Bestimmung.
Diese Klarstellung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines Arbeitnehmers, der seit 2007 bei seinem Arbeitgeber beschäftigt war. Der Arbeitgeber beschäftigte einschließlich des Klägers zehn eigene Arbeitnehmer. Im November 2009 kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristgerecht. Mit seiner Kündigungsschutzklage hat der Kläger geltend gemacht, bei der Anzahl der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer seien auch die vom Arbeitgeber eingesetzten Leiharbeitnehmer zu berücksichtigen. Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben die Klage abgewiesen, weil das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung finde.
Die Revision des Klägers hatte vor dem BAG Erfolg. Es sei nach Ansicht der Richter nicht auszuschließen, dass im Betrieb des Arbeitgebers mehr als zehn Arbeitnehmer i.S.d. § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG beschäftigt waren. Der Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern stehe nicht schon entgegen, dass sie kein Arbeitsverhältnis zum Betriebsinhaber begründet hätten. Die Herausnahme der Kleinbetriebe aus dem Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes solle der dort häufig engen persönlichen Zusammenarbeit, ihrer zumeist geringen Finanzausstattung und dem Umstand Rechnung tragen, dass der Verwaltungsaufwand, den ein Kündigungsschutzprozess mit sich bringt, die Inhaber kleinerer Betriebe typischerweise stärker belaste. Dies rechtfertige keine Unterscheidung danach, ob die den Betrieb kennzeichnende regelmäßige Personalstärke auf dem Einsatz eigener oder dem entliehener Arbeitnehmer beruhe. Das BAG hat die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Es stehe noch nicht fest, ob die im Kündigungszeitpunkt im Betrieb tätigen Leiharbeitnehmer aufgrund eines regelmäßigen oder eines für den Betrieb „in der Regel“ nicht kennzeichnenden Geschäftsanfalls beschäftigt waren (BAG, 2 AZR 140/12).
AGG: Altersbedingte Diskriminierung eines Stellenbewerbers
Sucht ein öffentlicher Arbeitgeber in einer an „Berufsanfänger“ gerichteten Stellenanzeige für ein Traineeprogramm „Hochschulabsolventen/Young Professionells“ und lehnt er einen 36jährigen Bewerber mit Berufserfahrung bei einer Rechtsschutzversicherung und als Rechtsanwalt ab, so ist dies ein Indiz für eine Benachteiligung dieses Bewerbers wegen seines Alters. Der Arbeitgeber trägt dann die Beweislast dafür, dass ein solcher Verstoß nicht vorgelegen hat. Er darf sich darauf berufen, dass der Bewerber aufgrund seiner im Vergleich zu den Mitbewerbern schlechteren Examensnoten nicht in die eigentliche Bewerberauswahl einbezogen worden ist.
So entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer öffentlich-rechtlichen Krankenhausträgerin. Diese hatte Zeitungsinserate aufgegeben, in denen es u.a. hieß: „Die C. hat in den kommenden Jahren einen relevanten Bedarf an Nachwuchsführungskräften. Um diesen abzudecken, gibt es ein spezielles Programm für Hochschulabsolventen/Young Professionells: Traineeprogramm an der C. Dabei sollen jährlich zunächst zwei Hochschulabsolventen rekrutiert und dem Programm „C“ zugeführt werden. Da es sich per definitionem um Berufsanfänger handelt, stehen neben den erworbenen Fähigkeiten vor allem die persönlichen Eigenschaften im Mittelpunkt.“ Der damals 36-jährige Kläger, ein Volljurist mit mehrjähriger Berufserfahrung, erhielt auf seine Bewerbung eine Absage. Dies sah er als eine Benachteiligung wegen seines Alters an und verlangte von der Beklagten eine Entschädigung. Die Beklagte bestritt eine solche Diskriminierung und machte geltend, sie habe eine Auswahl nach den Examensnoten getroffen und nur diejenigen Bewerber in Betracht gezogen, die Examensnoten von gut oder sehr gut aufgewiesen hätten. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.
Die Revision des Klägers hatte vor dem Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts teilweise Erfolg. Die Stellenausschreibung, die sich an Hochschulabsolventen/Young Professionells und an Berufsanfänger richtet, begründe nach Ansicht der Richter ein Indiz für eine Benachteiligung des abgelehnten Klägers wegen dessen Alters. Dieses Indiz könne die Beklagte widerlegen, wenn sie nur die Bewerber mit den besten Examensnoten in die Bewerberauswahl einbezogen hätte. Das Grundgesetz gebe nämlich vor, dass sie als öffentliche Arbeitgeberin die Stellen nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung der Bewerber besetzen müsse. Da der Kläger eine solche Bewerberauswahl durch die Beklagte bestritten hatte, war die Sache zur weiteren Sachaufklärung und erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückzuverweisen (BAG, 8 AZR 429/11).
Arbeitslohn: Pflicht zur Lohnzahlung besteht auch bei Krankheitsanfälligkeit
Arbeitnehmer, die eine neue Stelle antreten, müssen keine körperliche Verfassung mitbringen, die jeglichen künftigen Arbeitsausfall ausschließt
So sah es das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln im Fall eines Angestellten. Dieser hatte seine ehemalige Arbeitgeberin verklagt, weil sie seine Zahlungsansprüche aus einem beendeten Dienst¬verhältnis nicht beglichen hatte. Streitpunkt war, dass sich der Arbeitnehmer innerhalb kurzer Zeit zweimal arbeitsunfähig gemeldet hatte. Daraufhin nahm die Arbeitgeberin die ihr nach dem Kündigungsschutzgesetz eingeräumte Möglichkeit wahr, dem Arbeitnehmer während der gesetzlichen Wartezeit zu kündigen. Sie begründete ihre Entscheidung mit Zweifeln an der zufriedenstellenden Erfüllung der berufstypischen Aufgaben.
Da der Arbeitnehmer seine Arbeit an sich jedoch ordentlich erledigt hatte, entschied das LAG Köln zu seinen Gunsten. Das Gericht war der Ansicht, dass ein Arbeitnehmer zwar objektiv für die von ihm ausgeübte berufliche Tätigkeit geeignet sein müsse. Dennoch schließe die grundsätzliche Eignung nicht aus, dass ein Angestellter unter Umständen eine höhere Krankheitsanfälligkeit als andere Beschäftigte entwickeln könne. Das sei jedoch für sich genommen noch kein Grund, Lohnzahlungen auszusetzen (LAG Köln, 7 Sa 847/11).
Bewerbungsgespräch: Frage nach Schwangerschaft ist auch bei Schwangerschaftsvertretung unzulässig
Der Arbeitgeber kann unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung redlicherweise keine Aufklärung über das Bestehen einer Schwangerschaft seitens der Bewerberin verlangen. Dies gilt auch, wenn nur ein befristeter Arbeitsvertrag begründet werden soll und feststeht, dass die Bewerberin während eines wesentlichen Teils der Vertragslaufzeit nicht arbeiten kann.
Diese für den Arbeitgeber schmerzliche Entscheidung traf das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln im Fall eines Arbeitgebers, der eine Schwangerschaftsvertretung suchte. Nachdem der Vertrag mit der Bewerberin geschlossen war, stellte sich heraus, dass auch sie schwanger war. Der Arbeitgeber erklärte daraufhin die Anfechtung des Vertrags wegen arglistiger Täuschung.
Das LAG machte jedoch deutlich, dass die Anfechtung unwirksam sei. Die Bewerberin sei bei Vertragsschluss nicht verpflichtet gewesen, das Bestehen der Schwangerschaft zu offenbaren. Ein Verschweigen von Tatsachen stelle nur eine Täuschung dar, wenn hinsichtlich dieser Tatsachen eine Aufklärungspflicht bestehe. Im Hinblick auf eine Schwangerschaft sei dies nach den Geboten von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte zur Vermeidung einer Geschlechtsdiskriminierung nicht der Fall. Unerheblich sei in diesem Zusammenhang, dass von Anfang an ein befristeter Arbeitsvertrag zwischen den Parteien in Rede gestanden habe. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sei die Frage nach der Schwangerschaft auch unzulässig, wenn ein befristeter Arbeitsvertrag begründet werden solle, und feststehe, dass die Bewerberin aufgrund der Schwangerschaft während eines wesentlichen Teils der Vertragslaufzeit nicht arbeiten könne (LAG Köln, 6 Sa 641/12; EuGH, C-109/00).
Baurecht
AGB: Eine Abkürzung der Verjährungsfrist für Werklohnansprüche ist unwirksam
Eine vom Auftraggeber in einem Bauvertrag gestellte Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB), mit der die Verjährungsfrist für den Werklohnanspruch des Auftragnehmers auf zwei Jahre abgekürzt wird, ist unwirksam.
So entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem entsprechenden Fall. Nach Ansicht der Richter benachteilige eine solche AGB den Auftragnehmer entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen (BGH, VII ZR 15/12).
Baumangel: Voraussetzungen für eine Haftung wegen arglistigem Verschweigen des Verkäufers
Der Verkäufer eines Hauses haftet nicht automatisch für jeden Mangel des verkauften Hauses.
Das machte das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz deutlich. Die Richter erläuterten, dass eine Haftung nur bestehe, wenn der Mangel offenbarungspflichtig war und der Verkäufer ihn gleichwohl arglistig verschwiegen habe. Für ein solch arglistiges Verschweigen müssten mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst müsse dem Verkäufer der Fehler bekannt gewesen sein, bzw. er müsse ihn zumindest für möglich gehalten haben. Sodann müsse er billigend in Kauf nehmen, dass dem Käufer dieser Fehler nicht bekannt sei. Und er müsse ebenso in Kauf nehmen, dass der Käufer den Kaufvertrag bei der Offenlegung des Mangels nicht oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt geschlossen hätte.
In dem betreffenden Fall schied eine Haftung des Verkäufers wegen eines Käferbefalls des Hauses aus. Es war nicht zu klären, welches Ausmaß der Käferbefall angenommen hatte, als der Verkäufer aus dem Haus auszog. Zu berücksichtigen sei nämlich, dass Käfer häufig lediglich vereinzelt auftreten und erst im Rahmen von Renovierungsarbeiten entdeckt würden. Das Vorliegen des Käferbefalls lasse noch nicht darauf schließen, dass der Verkäufer über den Umfang voll und ganz informiert war. Da ihm diese Kenntnis nicht nachgewiesen werden konnte, musste der Verkäufer für den Mangel nicht haften (OLG Koblenz, 2 U 1020/11).
Schlussrechnung: Auch nach zwei Monaten sind Einwendungen noch möglich
Auch wenn die VOB/B eine Prüfung der Schlussrechnung innerhalb von zwei Monaten vorsieht, ist der Bauherr mit Einwendungen nach Ablauf dieser Zeit nicht ausgeschlossen.
Hierauf machte das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz aufmerksam. Die Richter erläuterten, dass die Prüfungsfrist lediglich eine Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlussrechnung sei. Sie führe jedoch nicht zum Ausschluss von Einwendungen gegen die Schlussrechnung. Vielmehr finde eine Sachprüfung statt (OLG Koblenz, 2 U 1001/11).
Gerichtsstand: Die Vergütung aus einem Bauvertrag ist am Sitz des Bauherren einzuklagen
Zahlt der Bauherr die vereinbarte Vergütung nicht, muss ihn der Bauunternehmer an seinem (Wohn-)Sitz verklagen.
Eine Klage am Ort des Bauwerks hat dagegen nach einer Entscheidung des Landgerichts (LG) Stralsund die Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts zur Folge. Die Richter machten deutlich, dass die Vorstellung von einer Bargeldübergabe an der Baustelle – jedenfalls beim „legalen“ Bruttogeschäft – in Zeiten eines weitgehend bargeldlosen Zahlungsverkehrs als Anachronismus erscheine. Zur Bestimmung des zuständigen Gerichts könne nicht auf einen „Schwarzbau“ abgestellt werden, bei dem der Bauhandwerker tatsächlich regelmäßig oder zumindest oftmals am Ort des Bauwerks „cash“ entlohnt wird. Diese Vorstellung werde von der Rechtsordnung nicht gebilligt (LG Stralsund, 6 O 77/11).
Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht (WEG)
Aktuelle Gesetzgebung: Mietrechtsänderungsgesetz passiert den Bundesrat
Der Bundesrat hat das Mietrechtsänderungsgesetz verabschiedet. Der Entwurf betrifft folgende Regelungskomplexe: Die energetische Modernisierung von Wohnraum, die Förderung des Contracting, die Bekämpfung des Mietnomadentums und den Kündigungsschutz bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Zudem werden die Länder ermächtigt, den Anstieg von Bestandsmieten auf lokalen Teilmärkten mit knappem Angebot abzudämpfen. Nach der erfolgten Verabschiedung des Gesetzes im Bundesrat muss es nun noch ausgefertigt und verkündet werden. Die Änderungen werden voraussichtlich – je nach Verkündungstermin im Bundesgesetzblatt – Anfang April oder Anfang Mai 2013 in Kraft treten. Die Regelung zum Contracting werden zwei Monate danach wirksam.
Zu den Änderungen im Einzelnen:
1. Energetische Modernisierung
Das Mietrecht muss dafür sorgen, dass Nutzen und Lasten einer energetischen Modernisierung ausgewogen zwischen Vermieter und Mieter verteilt werden.
- Die Vorschriften über die Duldung von Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen (bisher: § 554 BGB) werden reformiert. Größeres Gewicht erhält der neu geschaffene Tatbestand der „energetischen Modernisierung“. Er umfasst Maßnahmen, die zur Einsparung von Endenergie in Bezug auf die Mietsache beitragen, etwa die Dämmung der Gebäudehülle oder den Einsatz von Solartechnik für die Warmwasserbereitung. Das schafft Rechtssicherheit für den investitionswilligen Vermieter. Rein klimaschützende Maßnahmen oder Maßnahmen wie die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach, deren Strom der Vermieter in das öffentliche Stromnetz einspeist, muss der Mieter zwar dulden. Sie berechtigen aber nicht zur Mieterhöhung.
- Energetische Modernisierungen sollen für eine begrenzte Zeit von drei Monaten nicht mehr zu einer Mietminderung (§ 536 BGB) führen. Ist etwa eine Dämmung der Außenfassade mit Baulärm verbunden, ist für die Dauer von drei Monaten die Mietminderung wegen dieser Beeinträchtigung ausgeschlossen. Ab dem vierten Monat kann eine Mietminderung wie bisher geltend gemacht werden, sofern die Baumaßnahme bis dahin nicht abgeschlossen und die Nutzung der Wohnung weiter beeinträchtigt ist. Der vorübergehende Minderungsausschluss gilt nur für energetische Modernisierungen. Bei anderen Modernisierungen (z.B. Modernisierung eines Bades) bleibt es beim unbeschränkten Minderungsrecht. Unberührt bleibt natürlich auch das Recht des Mieters zur Mietminderung, wenn die Wohnung wegen der Baumaßnahmen nicht mehr benutzbar ist.
- Das geltende Recht, dass die Kosten von Modernisierungsmaßnahmen mit jährlich maximal elf Prozent auf die Miete umgelegt werden können, wird nicht verändert (§ 559 BGB). Die Umlagemöglichkeit wird auch für die energetische Modernisierung nicht erhöht. Kosten für Erhaltungsaufwendungen, die mit Modernisierungen verbunden sind, berechtigen nicht zur Mieterhöhung. Dieser Abzugsposten wird im Mieterinteresse künftig ausdrücklich geregelt; diese Klarstellung fehlte im Gesetz bislang.
- Bisher konnte sich der Beginn von Modernisierungsmaßnahmen verzögern, wenn der Mieter vorträgt, dass die gesetzlich vorgesehene Umlage von Modernisierungskosten eine für ihn unzumutbare wirtschaftliche Härte sei. Diese Härtefallprüfung wird in das spätere Mieterhöhungsverfahren verlagert, damit die Modernisierung zunächst ohne Verzögerungen realisiert werden kann. Beruft sich also ein Mieter darauf, dass er nach seinem Einkommen eine spätere Modernisierungsumlage wirtschaftlich nicht verkraften kann, so kann der Vermieter die geplante Maßnahme dennoch durchführen, darf die Miete jedoch nicht erhöhen, sofern sein Einwand berechtigt ist. Das schafft Planungssicherheit in der Bauphase. Der Härteeinwand ist künftig schriftlich und fristgebunden vorzubringen; der Vermieter soll den Mieter in der Ankündigung aber auf Form und Frist hinweisen. Der Härtegrund der fehlenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird im Mieterhöhungsverfahren nach Abschluss der Maßnahmen geprüft, auch der Abwägungsmaßstab wird nicht verschärft. Der Mieter behält also seinen umfassenden Schutz vor Mieterhöhungen, die er finanziell nicht tragen kann. Er muss also, wenn der Härtegrund gegeben ist, trotz zu duldender Modernisierung später eine mögliche erhöhte Miete nicht zahlen.
- Die formalen Anforderungen an die Begründungspflichten des Vermieters bei Modernisierungen werden gesenkt, um überzogene Anforderungen zu vermeiden. Der Vermieter kann sich etwa auf anerkannte Pauschalwerte berufen, um die Wärmeleitfähigkeit alter Fenster zu beschreiben, die ausgetauscht werden sollen. Die Rechtsprechung verlangt hier bisher teilweise kostspielige Sachverständigengutachten.
- In den Vorschriften über die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) wird gesetzlich klargestellt, dass die energetische Ausstattung und Beschaffenheit bei der Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete zu berücksichtigen sind. Energetische Kriterien sollen so künftig auch verstärkt in Mietspiegeln abgebildet werden.
2. Contracting
Mit der Umstellung auf Contracting (gewerbliche Wärmelieferung durch ein spezialisiertes Unternehmen) kann Energie gespart oder effizienter genutzt werden. Vermieter, die bisher in Eigenregie für die Wärmeversorgung ihrer Häuser gesorgt haben, können einen Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung leisten, wenn sie einen gewerblichen Wärmelieferanten beauftragen, der in der Regel in eine neue, sparsamere Heizungsanlage investiert. Die Umlage der Contractingkosten auf den Mieter anstelle der bisherigen Heizkosten, und damit ein Umstellungsanspruch des Vermieters, wird gesetzlich geregelt. Wenn Vermieter von der Wärmeversorgung in Eigenregie auf Wärmelieferung durch einen gewerblichen Anbieter umstellen, können sie die Kosten dieser Wärmelieferung künftig unter folgenden Voraussetzungen als Betriebskosten auf den Mieter umlegen: In der Regel muss der Contractor eine neue Anlage errichten oder die Wärme aus einem Wärmenetz liefern, z.B. als Fernwärme oder aus einem Blockheizkraftwerk. Bei Bestandsanlagen, die noch effizient weiter betrieben werden können, kann er sich auch auf die verbesserte Betriebsführung beschränken. In jedem Fall muss die Umstellung für den Mieter kostenneutral sein. Außerdem muss die Umstellung rechtzeitig zuvor angekündigt werden, damit der betroffene Mieter prüfen kann, ob die Voraussetzungen für eine spätere Umlage der Wärmelieferkosten als Betriebskosten tatsächlich vorliegen.
3. Wirkungsvolles Vorgehen gegen das sogenannte Mietnomadentum
Gegen das sogenannte Mietnomadentum kann durch neue Verfahrensregeln verbessert vorgegangen werden:
- Räumungssachen sind künftig vorrangig von den Gerichten zu bearbeiten: Denn der Vermieter oder Verpächter kann auch bei wirksamer Kündigung des Vertrags seine Leistung – nämlich die Besitzüberlassung – nicht eigenmächtig zurückhalten. Hier ist eine besonders schnelle Durchführung des Verfahrens erforderlich, um nach Möglichkeit zu vermeiden, dass sich die Klageforderung monatlich um das auflaufende Nutzungsentgelt erhöht, falls der Mieter oder Pächter nicht zahlt. Deshalb sind Räumungsprozesse schneller als andere Zivilprozesse durchzuführen: Sie sind vorrangig zu terminieren; die Fristen zur Stellungnahme für die Parteien sind auf das unbedingt Notwendige zu reduzieren.
- Mit einer neuen Sicherungsanordnung kann der Mieter in Verfahren wegen Geldforderungen vom Gericht verpflichtet werden, für das während eines Gerichtsverfahrens Monat für Monat auflaufende Nutzungsentgelt eine Sicherheit (z.B. Bürgschaft, Hinterlegung von Geld) zu leisten. Damit soll verhindert werden, dass der Vermieter durch das Gerichtsverfahren einen wirtschaftlichen Schaden erleidet, weil der Mieter am Ende des Prozesses nicht mehr in der Lage ist, die während des Prozesses aufgelaufenen Mietschulden zu bezahlen. Befolgt der Mieter bei einer Räumungsklage wegen Zahlungsverzugs eine vom Gericht erlassene Sicherungsanordnung nicht, kann der Vermieter im Wege des einstweiligen Rechstschutzes schneller als bislang ein Räumungsurteil erwirken.
- Die in der Praxis entwickelte „Berliner Räumung“ erleichtert die Vollstreckung von Räumungsurteilen. Sie wird auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Hat ein Vermieter vor Gericht ein Räumungsurteil erstritten, soll der Gerichtsvollzieher die Wohnung räumen können, ohne gleichzeitig die – oft kostenaufwendige – Wegschaffung und Einlagerung der Gegenstände in der Wohnung durchzuführen. Die Räumung kann also darauf beschränkt werden, den Schuldner aus dem Besitz der Wohnung zu setzen. Auf diese Weise fällt kein Kostenvorschuss für Abtransport und Einlagerung der in der Wohnung verbleibenden Gegenstände an. Die Haftung des Vermieters für die vom Schuldner zurückgelassenen Gegenstände wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt.
- Wenn der Gerichtsvollzieher an der Wohnungstür klingelt, um ein Räumungsurteil zu vollstrecken, öffnet manchmal ein Unbekannter die Tür und behauptet, Untermieter zu sein. Da der Vermieter von der Untermiete nichts wusste, kann die Wohnung zunächst nicht geräumt werden, weil das Räumungsurteil nur gegen die Personen wirkt, die im Urteil benannt sind. Ein neuer Anspruch im einstweiligen Verfügungsverfahren gibt dem Vermieter die Möglichkeit, in dieser Situation schnell einen weiteren Räumungstitel auch gegen den unberechtigten Untermieter zu bekommen.
4. Unterbindung des „Münchener Modells“ bei der Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen
Der bewährte Mieterschutz bei der Umwandlung von Mietshäusern darf nicht durch das sogenannte Münchener Modell umgangen werden. § 577a BGB sieht derzeit einen Schutz vor Eigenbedarfskündigungen für drei Jahre vor, wenn Mietshäuser in Wohneigentum umgewandelt und die Wohnungen sodann veräußert werden. Die Landesregierungen können diese Frist für gefährdete Gebiete (Ballungsräume) bis auf zehn Jahre verlängern. Das „Münchener Modell“ ist dadurch geprägt, dass eine Personengesellschaft (z.B. eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts) ein Mietshaus von vornherein mit dem Ziel erwirbt, ihren Mitgliedern die Nutzung der Wohnungen zu ermöglichen und die Wohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Noch vor der Umwandlung kündigt die Gesellschaft einem oder mehreren Mietern wegen Eigenbedarfs einzelner Gesellschafter. Auf diese Weise wird der in § 577a BGB verankerte Schutz vor Eigenbedarfskündigungen nach Umwandlung in Wohneigentum umgangen. Diese Schutzlücke wird jetzt geschlossen.
5. Absenkung der Kappungsgrenze für Erhöhungen von Bestandsmieten bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete
Darüber hinaus wird in § 558 Abs. 3 BGB eine Regelung eingefügt, wonach die Bundesländer für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten per Rechtsverordnung die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete von 20 Prozent auf 15 Prozent absenken und so flexibel auf Mietsteigerungen besonders in Ballungsräumen reagieren können.
Kündigungsrecht: Rückstand von zwei Mieten muss nicht immer abgewartet werden
Eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs ist auch unterhalb der für die fristlose Kündigung geltenden Grenze des Gesetzes möglich. Es liegt jedoch keine „nicht unerhebliche“ Pflichtverletzung des Mieters vor, wenn der Mietrückstand eine Monatsmiete nicht übersteigt und die Verzugsdauer weniger als einen Monat beträgt.
Bei der notwendigen Bewertung einer Pflichtverletzung als „nicht unerheblich“ müsse nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) die Dauer und die Höhe des Zahlungsverzugs berücksichtigt werden. Nicht jeder geringfügige oder nur kurzfristige Zahlungsverzug rechtfertige die Annahme einer nicht unerheblichen Pflichtverletzung. In Anlehnung an die überwiegend vertretenen Auffassungen erschien dem BGH die Erheblichkeitsgrenze nicht überschritten, wenn der Rückstand eine Monatsmiete nicht übersteigt und zudem die Verzugsdauer weniger als einen Monat beträgt (BGH, VIII ZR 107/12).
Verbraucherrecht
Aktuelle Gesetzgebung: Patientenrechtegesetz passiert den Bundesrat
Das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz) hat den Bundesrat passiert und wird damit wie geplant am Tag nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Das Patientenrechtegesetz bündelt erstmals die Rechte von Patientinnen und Patienten und entwickelt sie in wesentlichen Punkten weiter. Das Gesetz umfasst folgende Regelungsbereiche:
- Der Behandlungsvertrag wird ausdrücklich im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Hier wird die Vertragsbeziehung zwischen Patienten und Ärzten, aber auch zu anderen Heilberufen, wie Heilpraktikern, Hebammen, Psycho- oder Physiotherapeuten, zentral geregelt.
- Patientinnen und Patienten müssen verständlich und umfassend informiert werden, etwa über erforderliche Untersuchungen, Diagnosen und beabsichtigte Therapien. Diese Informationspflicht besteht auch für die mit der Behandlung verbundenen Kostenfolgen: Werden Behandlungskosten nicht von der Krankenkasse übernommen und weiß dies der Behandelnde, dann muss er den Patienten vor dem Beginn der Behandlung entsprechend informieren. Auch muss der Behandelnde den Patienten unter bestimmten Voraussetzungen über einen Behandlungsfehler informieren.
- Die gesetzlich vorgeschriebene Aufklärung erfordert, dass grundsätzlich alle Patientinnen und Patienten umfassend über eine bevorstehende konkrete Behandlungsmaßnahme und über die sich daraus ergebenden Risiken aufgeklärt werden müssen. Damit sich der Patient seine Entscheidung gut überlegen kann, muss rechtzeitig vorher ein persönliches Gespräch geführt werden. Eine schriftliche Aufklärung reicht alleine nicht aus. Auch Patientinnen und Patienten, die aufgrund ihres Alters oder ihrer geistigen Verfassung nicht in der Lage sind, allein über die Behandlungsmaßnahme zu entscheiden, werden künftig verstärkt mit in den Behandlungsprozess eingebunden, indem das Gesetz festlegt, dass auch ihnen die wesentlichen Umstände der bevorstehenden Behandlung zu erläutern sind.
- Ferner werden auch die Dokumentationspflichten bei der Behandlung im Gesetz niedergeschrieben. Patientenakten sind vollständig und sorgfältig zu führen. Fehlt die Dokumentation oder ist sie unvollständig, wird im Prozess zulasten des Behandelnden vermutet, dass die nicht dokumentierte Maßnahme auch nicht erfolgt ist. Behandelnde sind künftig auch verpflichtet, zum Schutz von elektronischen Dokumenten eine manipulationssichere Software einzusetzen.
- Patientinnen und Patienten wird ein gesetzliches Recht zur Einsichtnahme in ihre Patientenakte eingeräumt. Dies darf nur unter strengen Voraussetzungen und künftig nur mit einer Begründung abgelehnt werden.
- Schließlich wird es in Haftungsfällen mehr Transparenz geben. Die wichtigen Beweiserleichterungen berücksichtigen die Rechtsprechung und werden klar geregelt. Damit wird künftig jeder im Gesetz nachlesen können, wer im Prozess was beweisen muss.
Auch die Versichertenrechte in der gesetzlichen Krankenversicherung werden gestärkt:
- Ein wichtiges Anliegen im Interesse von Patientinnen und Patienten ist die Förderung einer Fehlervermeidungskultur in der medizinischen Versorgung. Behandlungsfehlern möglichst frühzeitig vorzubeugen, hat höchste Priorität.
- Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stärkung der Rechte von Patientinnen und Patienten gegenüber den Leistungserbringern. Künftig sind die Kranken- und Pflegekassen verpflichtet, ihre Versicherten bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern zu unterstützen. Dies kann etwa durch Unterstützungsleitungen, mit denen die Beweisführung der Versicherten erleichtert wird, z.B. medizinischen Gutachten, geschehen.
- Zudem wird dafür gesorgt, dass Versicherte ihre Leistungen schneller erhalten. Krankenkassen müssen spätestens binnen drei, bei Einschaltung des medizinischen Dienstes binnen fünf Wochen über einen Leistungsantrag entscheiden. Bei vertragszahnärztlichen Anträgen hat die Krankenkasse innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden, der Gutachter nimmt innerhalb von vier Wochen Stellung. Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grunds für eine Fristüberschreitung, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt.
- Die Patientenbeteiligung wird weiter ausgebaut. Patientenorganisationen werden insbesondere bei der Bedarfsplanung stärker einbezogen und ihre Rechte im Gemeinsamen Bundesausschuss werden gestärkt.
Um insgesamt mehr Transparenz über geltende Rechte von Patientinnen und Patienten herzustellen, erstellt der Patientenbeauftragte der Bundesregierung künftig eine umfassende Übersicht der Patientenrechte und hält sie zur Information der Bevölkerung bereit.
Schadenersatzrecht: Ausfall eines Internetanschlusses
Bei einem mehrwöchigen Ausfall des DSL-Anschlusses kann der Kunde einen Schadenersatzanspruch haben.
Hierauf hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Falle des Kunden eines Telekommunikationsunternehmens hingewiesen. Durch einen Fehler des Unternehmens ließ sich der DSL-Internetanschluss ca. zwei Monate lang nicht nutzen. Da der Kunde über diesen Anschluss auch seinen Telefon- und Telefaxverkehr abwickelte, entstanden ihm Mehrkosten durch den Wechsel zu einem anderen Anbieter und für die Nutzung eines Mobiltelefons. Er verlangt zudem Schadenersatz in Höhe von täglich 50 EUR für den Fortfall der Möglichkeit, seinen DSL-Anschluss während des Zeitraums nutzen zu können.
Die Mehrkosten hat der BGH dem Kunden zugesprochen. Der Ersatz für den Ausfall der Nutzungsmöglichkeit eines Wirtschaftsguts müsse nach seiner Rechtsprechung dagegen grundsätzlich Fällen vorbehalten bleiben, in denen sich die Funktionsstörung typischerweise als solche auf die materielle Grundlage der Lebenshaltung signifikant auswirkt. In Anwendung dieses Maßstabs hat der BGH einen Schadenersatzanspruch wegen des Ausfalls des Telefaxes verneint. Dieses vermittele lediglich die Möglichkeit, Texte oder Abbildungen bequemer und schneller als auf dem herkömmlichen Postweg zu versenden. Der Fortfall des Telefaxes wirke sich zumindest in dem hier in Rede stehenden privaten Bereich nicht signifikant aus. Auch für den Ausfall des Festnetztelefons haben die Richter einen Schadenersatzanspruch abgelehnt. Allerdings stelle die Nutzungsmöglichkeit des Telefons ein Wirtschaftsgut dar, dessen ständige Verfügbarkeit für die Lebensgestaltung von zentraler Wichtigkeit sei. Die Ersatzpflicht des Schädigers für die entgangene Möglichkeit, Nutzungsvorteile aus einem Wirtschaftsgut zu ziehen, entfalle jedoch, wenn dem Geschädigten ein gleichwertiger Ersatz zur Verfügung stehe und ihm der hierfür anfallende Mehraufwand ersetzt werde. Dies war vorliegend der Fall, weil der Kunde im maßgeblichen Zeitraum ein Mobiltelefon nutzte und er die dafür angefallenen zusätzlichen Kosten ersetzt verlangen konnte.
Demgegenüber hat der BGH dem Kunden dem Grunde nach Schadenersatz für den Fortfall der Möglichkeit zuerkannt, seinen Internetzugang für weitere Zwecke als für den Telefon- und Telefaxverkehr zu nutzen. Die Nutzbarkeit des Internets sei ein Wirtschaftsgut, dessen ständige Verfügbarkeit seit längerer Zeit auch im privaten Bereich für die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung typischerweise von zentraler Bedeutung sei. Das Internet stelle weltweit umfassende Informationen in Form von Text-, Bild-, Video- und Audiodateien zur Verfügung. Es ersetze wegen der leichten Verfügbarkeit der Informationen immer mehr andere Medien, wie zum Beispiel Lexika, Zeitschriften oder Fernsehen. Darüber hinaus ermögliche es den weltweiten Austausch zwischen seinen Nutzern, etwa über E-Mails, Foren, Blogs und soziale Netzwerke. Zudem werde es zunehmend zur Anbahnung und zum Abschluss von Verträgen, zur Abwicklung von Rechtsgeschäften und zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Pflichten genutzt. Damit habe sich das Internet zu einem die Lebensgestaltung eines Großteils der Bevölkerung entscheidend mitprägenden Medium entwickelt, dessen Ausfall sich signifikant im Alltag bemerkbar mache.
Hinweis: Zur Höhe des Schadenersatzes hat der BGH ausgeführt, dass der Kunde einen Betrag verlangen könne, der sich nach den marktüblichen, durchschnittlichen Kosten richte, die in dem betreffenden Zeitraum für die Bereitstellung eines DSL-Anschlusses mit der vereinbarten Kapazität ohne Telefon- und Faxnutzung angefallen wären, bereinigt um die auf Gewinnerzielung gerichteten und sonstigen, eine erwerbwirtschaftliche Nutzung betreffenden Wertfaktoren. Einzelheiten müsse nun das Berufungsgericht klären, an das der Rechtsstreit zurückverwiesen wurde (BGH, III ZR 98/12).
Reiserücktrittsversicherung: Versicherungsschutz kann auch bei Grunderkrankung bestehen
Der Versicherungsschutz in der Reiserücktrittsversicherung wird nicht durch eine dem Versicherungsnehmer bekannte Grunderkrankung ausgeschlossen. Das gilt auch, wenn diese nach der Erfahrung gelegentlich Akutbeschwerden verursachen kann.
So entschied das Landgericht (LG) Duisburg im Fall eines Mannes, der eine Reise wegen massiver Schmerzen im LWS-Bereich mit radikulären Symptomen in beiden Beinen nicht antreten konnte. Die Richter machten in ihrer Entscheidung zwei deutliche Aussagen:
- Die Beschwerden des Versicherungsnehmers waren eine schwere Erkrankung. Die planmäßige Durchführung der Reise war ihm nicht zumutbar. Die Voraussetzungen des Versicherungsschutzes lagen damit grundsätzlich vor.
- Folgen die Beschwerden aus einer Grunderkrankung, die bei Abschluss der Versicherung bereits bestand, ist dies unerheblich, soweit die Erkrankung für den Versicherungsnehmer später unerwartet eintritt.
Entscheidungserheblich war hier das „unerwartet“. Die Klage ging für den Mann verloren, weil er bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses regelmäßig unter starken Beschwerden litt und sich in ärztlicher Behandlung befand (LG Duisburg, 7 S 187/11).
Verkehrsrecht
Autowerkstatt: Haftung für Fehldiagnose bei einem Kostenvoranschlag
Kfz-Betriebe unterliegen bei gebührenpflichtigen Kostenvoranschlägen der strengen Werkvertragshaftung, wenn die Fehlerfeststellung unzulänglich ist, weil sie allein auf einem elektronischen Diagnosegerät beruht.
So hat das Amtsgericht (AG) Kassel rechtskräftig entschieden. Im Urteilsfall hatte der Kunde eine Markenwerkstatt aufgesucht, weil die Servolenkung seines Pkw schwergängig war. Ein Werkstattmitarbeiter führte eine Fehlerdiagnose mit Hilfe eines elektronischen Diagnosegeräts durch. Als Schadensursache wurde ein Ausfall der Pumpe für die Servolenkung angezeigt. Dementsprechend hieß es im Kostenvoranschlag (KVA) „Pumpe defekt“. Der Kunde zahlte für den Kostenvoranschlag 94,72 Euro, ließ die Reparatur aber in einer freien Werkstatt durchführen. Diese tauschte die Pumpe aus, doch die Schwergängigkeit der Lenkung blieb. Erst durch die Arbeiten im Motorraum, jedoch vor Ausbau der Pumpe, war erkennbar geworden, dass Korrosion am Kreuzgelenk der Lenkstange die wahre Ursache war. Den Rost zu entfernen, hätte rund 150 Euro gekostet. Für den Tausch der Pumpe musste der Kunde aber 537,04 Euro zahlen. In Höhe der Differenz nahm er bei der Werkstatt, die den Kostenvoranschlag erstellt hatte, Regress. Diese habe es fahrlässig versäumt, den Kunden darauf hinzuweisen, dass ihre Fehlerfeststellung mittels Diagnosegerät keine verlässliche Basis, sondern – entgegen der Kundenerwartung – nur eine vorläufige Einschätzung enthalte (AG Kassel, 423 C 4454/11).
Ausfallschaden: Neuwagen war im Unfallzeitpunkt schon bestellt
Wie lange hat der Geschädigte Anspruch auf Ersatz des Ausfallschadens (Mietwagen und/oder Nutzungsausfall), wenn er im Unfallzeitpunkt bereits ein neues Fahrzeug bestellt hatte? Ein BGH-Urteil aus dem Jahr 2007 liefert die Antwort auf diese Frage. Das Urteil zeigt aber auch, dass zwei Konstellationen strikt auseinandergehalten werden müssen.
In dem betreffenden Fall hatte der Fahrzeugeigentümer schon einen Neuwagen bestellt, als er mit seinem Fahrzeug unverschuldet verunfallte. Die Wiederbeschaffungsdauer im Schadengutachten für das verunfallte Fahrzeug hatte der Schadengutachter mit 14 Tagen geschätzt, der Neuwagen sollte aber voraussichtlich erst in etwa acht Wochen geliefert werden. Der Versicherer lehnte eine Nutzungsausfallentschädigung für mehr als 14 Tage ab. Er meinte, der Geschädigte hätte einen Gebrauchtwagen kaufen müssen, den er bei Lieferung des Neuwagens wiederverkaufen könne. Er habe eben nur Anspruch auf einen gleichwertigen Gebrauchten, und der sei in den üblichen 14 Tagen beschaffbar gewesen.
Das sahen die Richter am BGH anders: Für einen relativ kurzen Zeitraum zur Überbrückung einen Gebrauchtwagen zu kaufen und wiederzuverkaufen, berge wirtschaftliche Risiken. Diese seien sorgfältig mit der Mehrbelastung des Schädigers durch eine maßvoll verlängerte Nutzungsausfallentschädigung abzuwägen.
Im Ergebnis bedeutet das wohl, dass der Fahrzeugeigentümer bei der Relation 14 Tage zu acht Wochen, also sechs Wochen mehr, den Ausfallschaden bis zur Lieferung des Neuen dem Schädiger anlasten kann. Und wenn sich die Lieferung des Neuwagens verzögern sollte, wodurch sich das Verhältnis zu Ungunsten verschiebt, ist das nicht schädlich. Denn der BGH hat betont, dass es auf die Erkenntnismöglichkeiten des Geschädigten zum Unfallzeitpunkt ankommt.
Wichtig: In dem Urteil hat der BGH aber auch gesagt: Wenn der Geschädigte erst nach dem Unfall statt einer Wiederbeschaffung auf gleichwertiger Basis einen Neuwagen mit Lieferzeit bestellt, ist das anders zu betrachten. Dabei wird nämlich keine bereits bestehende Planung gestört, sondern schlicht und einfach abweichend disponiert. Auf einen Neuwagen hat der Geschädigte aber keinen Anspruch, und damit auch nicht auf den Ausfallschaden bis zur Lieferung des Neuwagens (BGH, VI ZR 62/07).
Unfallschadensregulierung: Kosten für einen Kostenvoranschlag sind erstattungspflichtig
Holt der Geschädigte statt eines Schadengutachtens nur einen Kostenvoranschlag ein, muss der eintrittspflichtige Haftpflichtversicherer die dafür entstehenden Kosten ersetzen.
So entschied das Amtsgericht (AG) Gronau. Es machte deutlich, dass die Einholung eines kompletten Gutachtens unterhalb eines Schades von zirka 750 EUR im Normalfall – Ausnahmen gibt es – gegen die Schadenminderungspflicht verstoße. Deshalb solle derjenige, der dieser Pflicht Genüge tut, nicht auf den im Vergleich zum Schadengutachten weit niedrigeren Kosten sitzen bleiben (AG Gronau, 1 C 148/11).
Abschleppkosten: Keine Preisvergleichspflicht bei Erteilung des Abschleppauftrags
Der Geschädigte muss vor dem Abschleppauftrag keinen Preisvergleich zwischen verschiedenen Abschleppunternehmern vornehmen. Wenn – wie wohl immer – vor der Abschleppleistung kein Preis vereinbart wurde, darf der Abschleppunternehmer „das Übliche“ berechnen.
Eine Orientierungshilfe dafür biete die Preis- und Strukturumfrage des Verbands der Bergungs- und Abschleppunternehmer VBA, entschied das Amtsgericht (AG) Neuss. Eine maßvolle Überschreitung des sich aus der Strukturumfrage ergebenden Preises führe nicht sofort zur Unüblichkeit. Vielmehr gelte zusammenfassend: Was innerhalb des Umfrageergebniskorridors liegt, gehe werkvertraglich in Ordnung und gelte schadenrechtlich als erforderlich. Was darüber liegt, bedürfe eines näheren rechtlichen Blicks, ob es triftige Gründe für die Überschreitung gebe (AG Neuss, 85 C 3163/12).
Entziehung der Fahrerlaubnis: Absehen von der Entziehung bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
Ist der Angeklagte trotz seines fortgeschrittenen Alters noch unbestraft und sind keine Eintragungen im Verkehrszentralregister enthalten, kann bei einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort von einer Regelentziehung abgesehen werden.
So entschied es das Landgericht (LG) Dortmund im Fall eines 57-jährigen Autofahrers. Die Richter haben bei der Verurteilung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort von der gesetzlich vorgesehenen Regelentziehung abgesehen und nur ein Fahrverbot verhängt. Das haben sie damit begründet, dass der Angeklagte trotz seines fortgeschrittenen Alters bisher noch gänzlich unbestraft war. Zudem waren auch keinerlei Eintragungen im Verkehrszentralregister enthalten, obschon der Angeklagte täglich zu seiner Arbeitsstelle von Dortmund nach Düsseldorf mit dem Pkw unterwegs war. Hinzu kam, dass er sich sehr zeitnah im Anschluss an das Unfallgeschehen der Polizei gestellt hatte. Zudem war der Schaden vollständig reguliert worden (LG Dortmund, 45 Ns 173/12).
Abschließende Hinweise
Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 30. Juni 2013 beträgt – 0,13 Prozent.
Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,87 Prozent
- für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): 1,87 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 7,87 Prozent
Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:
- vom 01.07.2012 bis 31.12.2012: 0,12 Prozent
- vom 01.01.2012 bis 30.06.2012: 0,12 Prozent
- vom 01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent
- vom 01.01.2011 bis 30.06.2011: 0,12 Prozent
- vom 01.07 2010 bis 31.12.2010: 0,12 Prozent
- vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 Prozent
- vom 01.07 2009 bis 31.12.2009: 0,12 Prozent
- vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 Prozent
- vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 Prozent
- vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 Prozent
- vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 Prozent
- vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 Prozent
- vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 Prozent
- vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 Prozent
- vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 Prozent
- vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 Prozent
- vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 Prozent
- vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 Prozent
- vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 Prozent
- vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 Prozent
- vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 Prozent
- vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 Prozent
- vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 Prozent
- vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 Prozent
- vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 Prozent
Steuertermine im Monat März 2013
Im Monat März 2013 sollten Sie folgende Steuertermine beachten:
- Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): Anmeldung und Barzahlung bis zum 11.3.2013.
- Lohnsteuerzahler (Monatszahler): Anmeldung und Barzahlung bis zum 11.3.2013.
- Einkommensteuerzahler (vierteljährlich): Barzahlung bis zum 11.3.2013.
- Kirchensteuerzahler (vierteljährlich): Barzahlung bis zum 11.3.2013.
- Körperschaftsteuerzahler (vierteljährlich): Barzahlung bis zum 11.3.2013.
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen.
Bitte beachten Sie: Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch Überweisung endet am 14.3.2013. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Barzahlung und Zahlung per Scheck gilt!